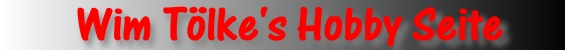
![]()
Preuß. Schnellzuglok S6 / BR13
Die Planung
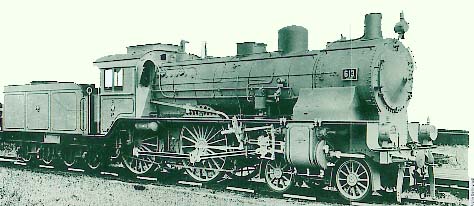 Nachdem ich nun
meine BR 80 fertiggestellt habe, wurde die
Zwischenzeit genutzt eine neue, etwas eigenwillige
Lokomotive als Modell zu erstellen. Es dauert
schon seine Zeit, bis das dargestellte Original,
in eine Spur 1 Modellgrösse realisiert ist. Da
gilt es, entsprechende Unterlagen, Dokumentationen
und Bildmaterial zu suchen und zusammen zu tragen.
Ein Original dieser Maschine gibt es leider,
zumindest hier in Deutschland nicht mehr.
Vielleicht steht noch irgendwo in Polen ein
Exemplar? Diesmal habe ich mir aber vorgenommen
die komplette Maschine zunächst einmal
zeichnerisch zu entwerfen und auch dann alle
Fertigungszeichnungen zu erstellen. Bei meiner
vorhergehenden BR 80 habe ich das nur bedingt
gemacht. Es wurden immer nur Entwürfe bzw.
Machbarkeitsstudien erstellt, aber praktisch keine
direkt brauchbaren Zeichnungen. Heute ärgert mich
das, aber die gemachten Erfahrungen fliessen dafür
voll in die Entwicklung der S 6 / BR 13
ein
Nachdem ich nun
meine BR 80 fertiggestellt habe, wurde die
Zwischenzeit genutzt eine neue, etwas eigenwillige
Lokomotive als Modell zu erstellen. Es dauert
schon seine Zeit, bis das dargestellte Original,
in eine Spur 1 Modellgrösse realisiert ist. Da
gilt es, entsprechende Unterlagen, Dokumentationen
und Bildmaterial zu suchen und zusammen zu tragen.
Ein Original dieser Maschine gibt es leider,
zumindest hier in Deutschland nicht mehr.
Vielleicht steht noch irgendwo in Polen ein
Exemplar? Diesmal habe ich mir aber vorgenommen
die komplette Maschine zunächst einmal
zeichnerisch zu entwerfen und auch dann alle
Fertigungszeichnungen zu erstellen. Bei meiner
vorhergehenden BR 80 habe ich das nur bedingt
gemacht. Es wurden immer nur Entwürfe bzw.
Machbarkeitsstudien erstellt, aber praktisch keine
direkt brauchbaren Zeichnungen. Heute ärgert mich
das, aber die gemachten Erfahrungen fliessen dafür
voll in die Entwicklung der S 6 / BR 13
ein

Ein erhebliches Problem bei Realisierung der besagten Modellgrösse ist auch hier die richtig funktionierende Heusinger-Steuerung. Das hat schon bei der BR 80 graue Haare gekostet. Wie sich aber herausstellte, haben die vielen Versuche letztlich zum Erfolg geführt und es funktioniert. Auch diese Erfahrung habe ich umgesetzt und ein Computerprogramm geschrieben, dass nach Eingabe relevanter Modelleckdaten, eine kompl. Berechnung der Heusinger-Steuerung abliefert. Auf Basis dieser Berechnungen, wurden dann auch die Zeichnungen für die Steuerung erstellt.
Die Realisierung der Lokomotive
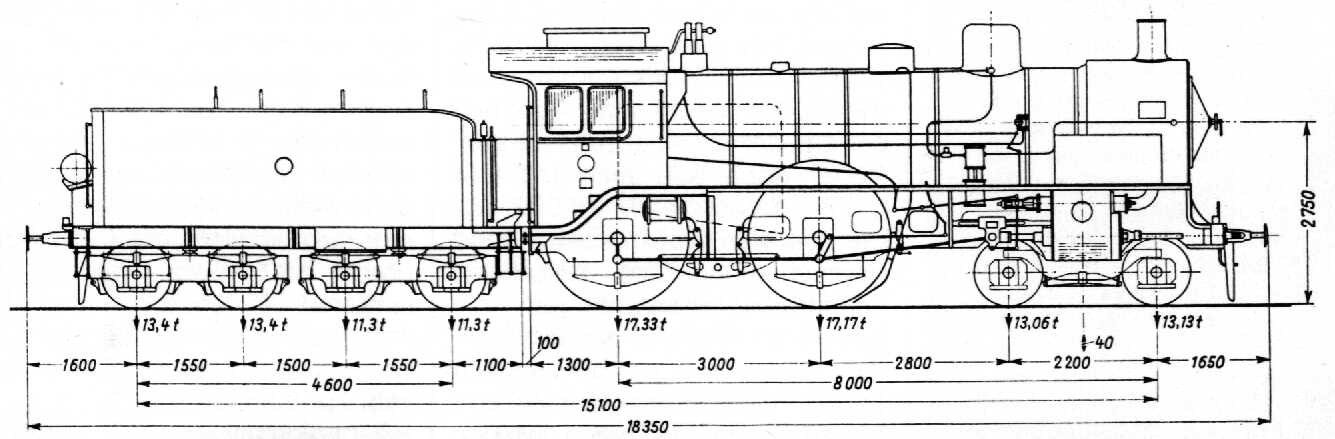 Wenn Sie die
Möglichkeit haben Entwürfe und Zeichnungen mit CAD
am Computer zu erstellen, kann schon hierbei viel
Entwicklung betrieben werden. Mit wenigen
Handhabungen können entwickelte Komponenten am
Bildschirm zusammengebaut werden und somit schon
vor der eigentlichen Fertigung dieser Teile, ein
Zusammenspiel mit anderen Baugruppen dargestellt
und überprüft werden. Hinsichtlich des
Modell-Massstabes habe ich mich auf ein Verhälnis
1:30 entschieden. Als Verbindungselemente habe ich
überwiegend Modellschrauben der Grösse M 3, M 2
und in Ausnahmefällen auch schon mal M 1,6
gewählt. Alle Gewinde für Stoppbuchsen,
Verschraubungen, Muffen und Nippel etc. sind mit
Metrischem Feingewinde versehen.
Wenn Sie die
Möglichkeit haben Entwürfe und Zeichnungen mit CAD
am Computer zu erstellen, kann schon hierbei viel
Entwicklung betrieben werden. Mit wenigen
Handhabungen können entwickelte Komponenten am
Bildschirm zusammengebaut werden und somit schon
vor der eigentlichen Fertigung dieser Teile, ein
Zusammenspiel mit anderen Baugruppen dargestellt
und überprüft werden. Hinsichtlich des
Modell-Massstabes habe ich mich auf ein Verhälnis
1:30 entschieden. Als Verbindungselemente habe ich
überwiegend Modellschrauben der Grösse M 3, M 2
und in Ausnahmefällen auch schon mal M 1,6
gewählt. Alle Gewinde für Stoppbuchsen,
Verschraubungen, Muffen und Nippel etc. sind mit
Metrischem Feingewinde versehen.
Sicherlich muss
ich auch bei dieser Maschine bei verschiedenen
Konstruktionsmerkmalen gegenüber dem Original
manchmal ein bisschen Stielbruch begehen. Da die
Maschine auch ein funktionstüchtiges Modell sein
soll, werde ich wohl einiges an Filegran
weglassen, anders gestalten oder vereinfachen. Die
Maschine soll griffig sein und nicht nach jeder
Handhabung gerichtet werden.
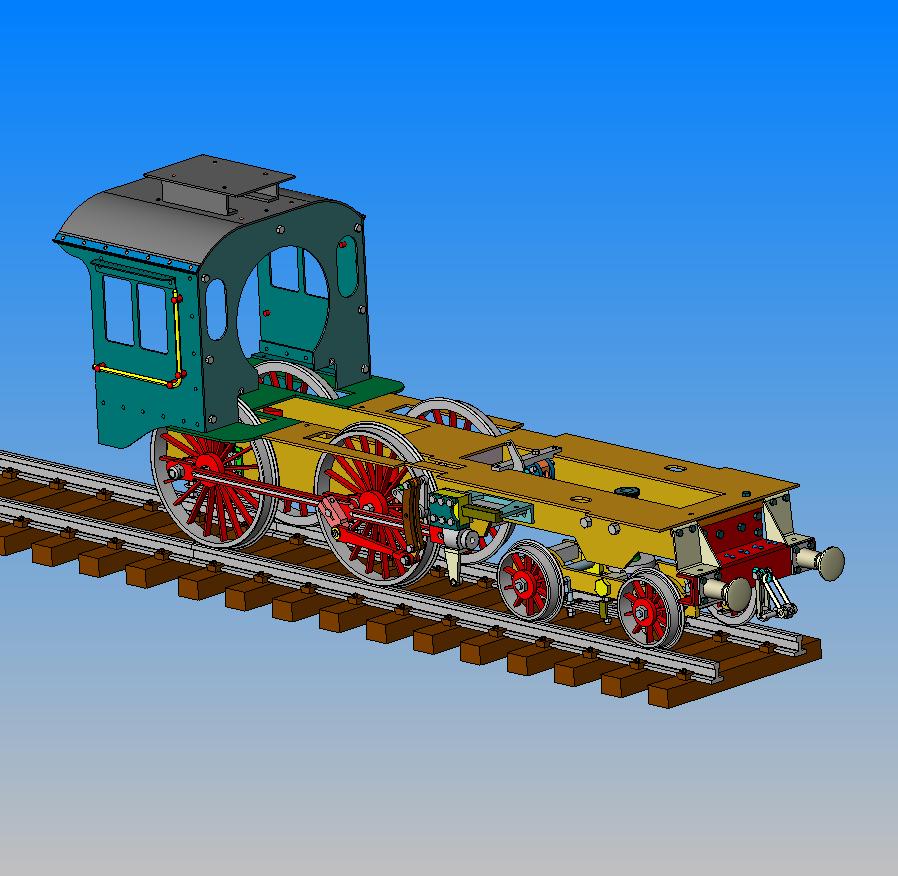 Der Massstab 1:30
ist ohnehin nach meiner Meinung das unterste Mass
der Machbarkeit für eine Heusinger-Steuerung. Wie
schon bei meiner BR 80 habe ich auch bei diesem
Modell eine Flachschiebersteuerung realisiert.
Flachschieber sind einfach dicht und das wirkt
sich sich sehr vorteilhaft auf die Laufleistung
der Maschine
aus.
Der Massstab 1:30
ist ohnehin nach meiner Meinung das unterste Mass
der Machbarkeit für eine Heusinger-Steuerung. Wie
schon bei meiner BR 80 habe ich auch bei diesem
Modell eine Flachschiebersteuerung realisiert.
Flachschieber sind einfach dicht und das wirkt
sich sich sehr vorteilhaft auf die Laufleistung
der Maschine
aus.
Durch eine besondere Konstruktion des vorderen Drehgestells ist es mir gelungen, dass die Maschine einen Gleisradius von 1175 mm durchfahren kann. Ich gehe diesbezüglich bei der Vorstellung der Baugruppe Drehgestell nochmals darauf ein.
An hand der ersten Zeichnungen habe ich als ungeduldiger Mensch meine Dreh- u. Fräsmaschine angeschmissen und gewerkelt was das Zeug hält. Die ersten Ergebnisse sind schon da und ich möchte sie Euch auch nicht vorenthalten.
Der Maschinenrahmen
Der
Maschinenrahmen ist aus einem Messingwinkel 30 x
15 x 2 gefertigt, wobei eine Hälfte des
Winkelsteeges bis auf 6 mm abgeschnitten wurde.
Dadurch wurde eine gute Biegesteifigkeit
erreicht. Beide Rahmenteile wurden zur weiteren
genauen Bearbeitung spiegelbildlich zusammen
verschraubt und anschliessen auf der Fräsmaschine
alle erforderlichen Bohrungen für die
Querverbinder eingebracht. Anschliessend habe ich
dann die beiden Lagertaschen für die Treib-u.
Kuppelachsen eingebracht. Die Zentrale dieser
Achslager muss unbedingt identisch mit der
Kuppelbolzenzentrale der Kuppelstangen
übereinstimmen.
 Ansonsten gibt es
später Laufprobleme. Ich habe mir vorher eine
Bohr-Schablone erstellt, wonach auch die
Kuppelstangen genau gebohrt
wurden.
Ansonsten gibt es
später Laufprobleme. Ich habe mir vorher eine
Bohr-Schablone erstellt, wonach auch die
Kuppelstangen genau gebohrt
wurden.
Nach
Anfertigung der Querverbinder konnte der
Maschinenrahmen erstmalig zusammen geschraubt
werden. Die vier Achslagergehäuse wurden
anschliessend in die Lagertaschen eingepasst.
Zur sauberen
Führung der Lagergehäuse sind radseitig,
beiderseits des Lagers, Führungslaschen
angebracht, die so ausgebildet sind, dass sie zur
Schiene hin über einen Querriegel verbunden
werden. Dadurch wird verhindert, dass das Radlager
herausfällt.
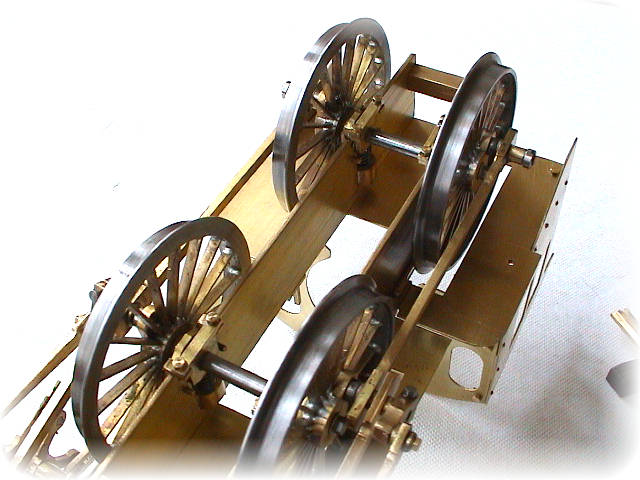 Die Führung
sollte jedoch nicht zu stramm laufen, damit
seitenunterschiedliche Federwege nicht zu einer
Verklemmung der Lagergehäuse führen. Wie auf dem
Bild zu sehen, ist oberhalb des Lagergehäuses die
Federung eingebaut, Die Feder endet Rahmenseitig
in einem im Rahmen eingelöteten Federtopf und wird
auf Gegenseite durch einen Arretierstift auf
dem Lagergehäuse, am
Herausspringen gehindert.Die endliche
Federkomponente muss später, entsprechend dem
Gewichte der Maschine, genau bestimmt werden.
Damit auch dem Original ein wenig entsprochen
wird, sollen auch Federpakete, als Attrappe,
eingebaut werden.
Die Führung
sollte jedoch nicht zu stramm laufen, damit
seitenunterschiedliche Federwege nicht zu einer
Verklemmung der Lagergehäuse führen. Wie auf dem
Bild zu sehen, ist oberhalb des Lagergehäuses die
Federung eingebaut, Die Feder endet Rahmenseitig
in einem im Rahmen eingelöteten Federtopf und wird
auf Gegenseite durch einen Arretierstift auf
dem Lagergehäuse, am
Herausspringen gehindert.Die endliche
Federkomponente muss später, entsprechend dem
Gewichte der Maschine, genau bestimmt werden.
Damit auch dem Original ein wenig entsprochen
wird, sollen auch Federpakete, als Attrappe,
eingebaut werden.
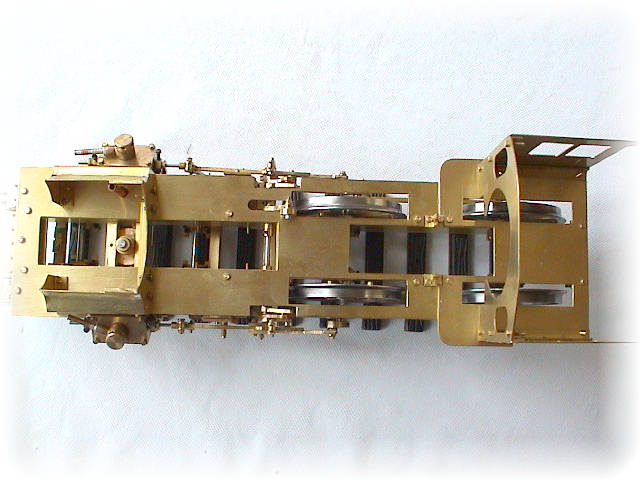 In den Bildern
des aktuellen Baufortschrittes ist dieses schom zu
sehen!
In den Bildern
des aktuellen Baufortschrittes ist dieses schom zu
sehen!
Alle im Rahmen
später noch einzubringen Bohrungen, z.B. für die
Zylinderbefestigung oder die Halterung für das
Drehgestelllager etc. werden später nach den
jeweils anzubauenden Komponenten, genau vermessen
und bestimmt. Ich habe hierfür den Rahmen kompl.
gelassen und all diese Arbeiten auf meinem
kombinierten Bohr-u. Fräswerk
ausgeführt.
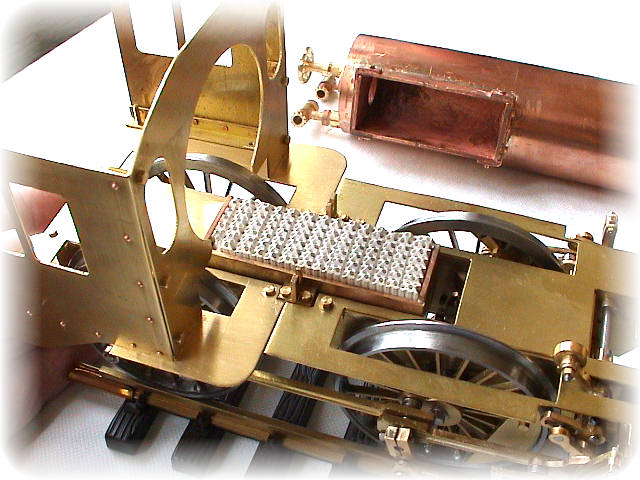
Der Maschinenrahmen schliesst zum Kessel hin mit einem durchbrochenen 2 teiligen Bodenblech ab. Einer der Durchbrüche liegt im Bereich der Feuerbuchse des Kessels. Dort wird, wie auf dem Bild zu sehen, der Keramikbrenner angeordnet ( Diese Art der Befeuerung wurde später geändert ). Im Bereich des Brenners ist die Bodenplatte geteilt und der so abgeteilte Plattenbereich, nimmt das Führerhaus auf. Die auf den Bildern zu sehenden und noch offenen Rad-Schutzkästen sind noch in Fertigung.
Das Drehgestell
Der
Drehgestellrahmen ist aus Flachmessing 20 x 2
gefräst und herausgearbeitet.
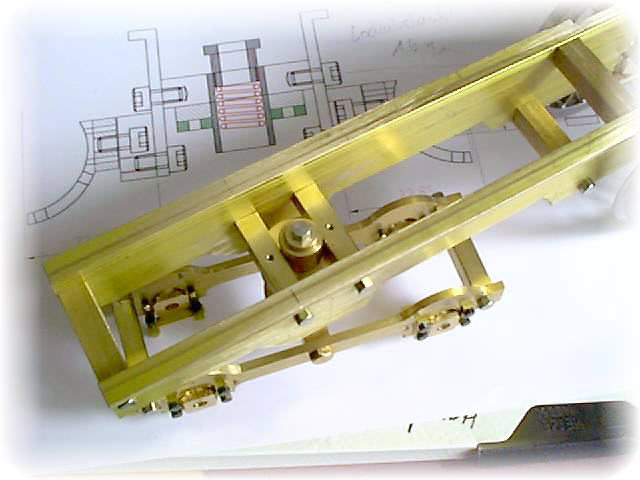 Ähnlich
dem Maschinenrahmen sind auch hier die
Laufradachsen angeordnet und ausgebildet. Die
Achsen selbst sind nicht gefedert, verfügen aber
dennoch über ausreichenden
Bewegungshub.
Ähnlich
dem Maschinenrahmen sind auch hier die
Laufradachsen angeordnet und ausgebildet. Die
Achsen selbst sind nicht gefedert, verfügen aber
dennoch über ausreichenden
Bewegungshub.
Das Drehgestell selbst ist über eine ausgeklügelten Anordnung, kardanisch aufgehängt und mit dem Hauptrahmen verbunden. In dieser Aufhängung befindet sich auch eine zentrale Abfederung.
Ursprünglich, wie auf dem Bild zu sehen, war die Aufhängung an einen Querverbinder in der Mitte des Drehgestells, zentral, über einen Bolzen angelenkt. Bei den ersten Rollversuchen im Gleisradius, liess diese Konstruktion aber nur Radien von min. 2500 mm zu.
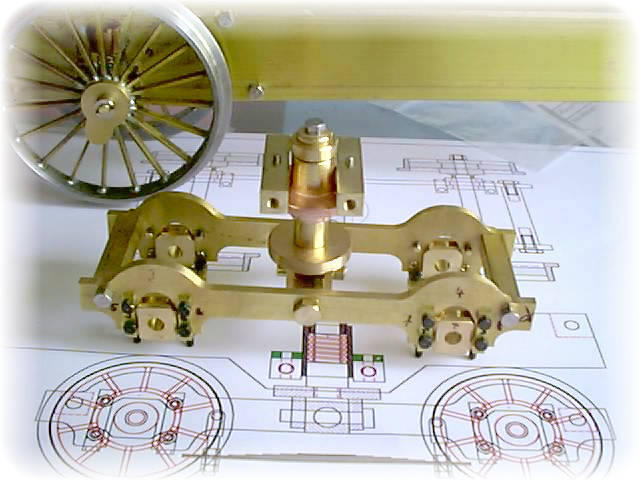 Durch eine
Änderung des Querverbinders hat das Drehgestell
jetzt die Möglichkeit nach jeder Seite hin um 8 mm
auszuweichen.
Somit kann die
gesamte Maschine jetzt Radien von min. 1175 mm
ohne
Durch eine
Änderung des Querverbinders hat das Drehgestell
jetzt die Möglichkeit nach jeder Seite hin um 8 mm
auszuweichen.
Somit kann die
gesamte Maschine jetzt Radien von min. 1175 mm
ohne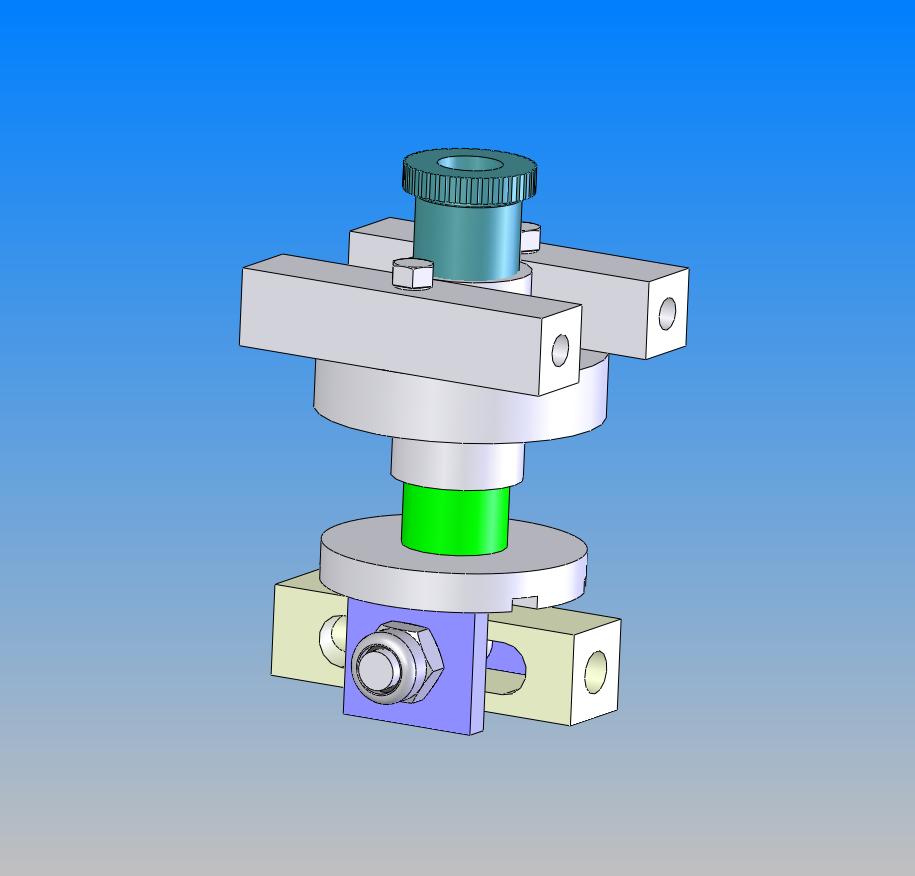 Probleme durchfahren.
Um die
Leichtgängigkeit noch zu erhöhen wurde die
Spurweite des mittleren Treibradsatzes gegenüber
des hinteren Kuppelradsatzes um ca. 1.5 mm kleiner
gewählt. Auf der Abblidung ist die Situation sehr
gut zu erkennen. Es wird noch an einer
Einrichtung gearbeitet, die dafür sogt, dass das
Drehgestell beim Übergang von Kurvenfahrt in den
Geradeausbetrieb durch eine Blattfeder wieder in
die Neutralstellung gedrückt
wird.
Probleme durchfahren.
Um die
Leichtgängigkeit noch zu erhöhen wurde die
Spurweite des mittleren Treibradsatzes gegenüber
des hinteren Kuppelradsatzes um ca. 1.5 mm kleiner
gewählt. Auf der Abblidung ist die Situation sehr
gut zu erkennen. Es wird noch an einer
Einrichtung gearbeitet, die dafür sogt, dass das
Drehgestell beim Übergang von Kurvenfahrt in den
Geradeausbetrieb durch eine Blattfeder wieder in
die Neutralstellung gedrückt
wird.
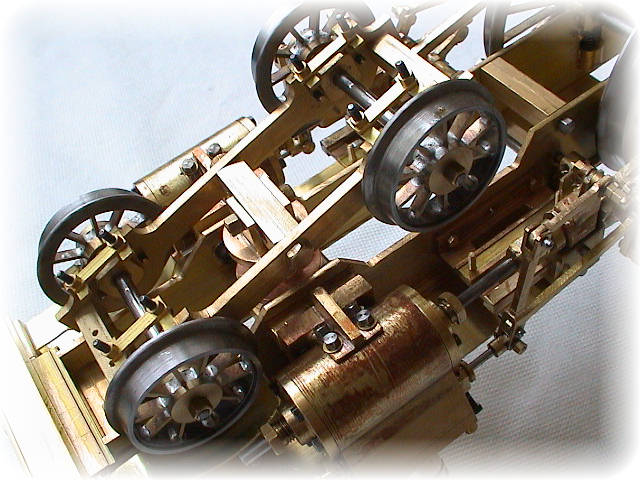 Erste Versuche
verliefen sehr erfolgreich. Das Drehgestell selbst
ist durch die stabiele Bauweise und Art der
Laufräder, relativ schwer. Das wird zusätzlich
noch durch die Federkomponente in der
Drehpunktaufhängung im Rahmen erhöht. Dadurch wird
eine sichere Spurführung erziehlt, die verhindert,
dass das Drehgestell aus den Schienen
springt.
Erste Versuche
verliefen sehr erfolgreich. Das Drehgestell selbst
ist durch die stabiele Bauweise und Art der
Laufräder, relativ schwer. Das wird zusätzlich
noch durch die Federkomponente in der
Drehpunktaufhängung im Rahmen erhöht. Dadurch wird
eine sichere Spurführung erziehlt, die verhindert,
dass das Drehgestell aus den Schienen
springt.
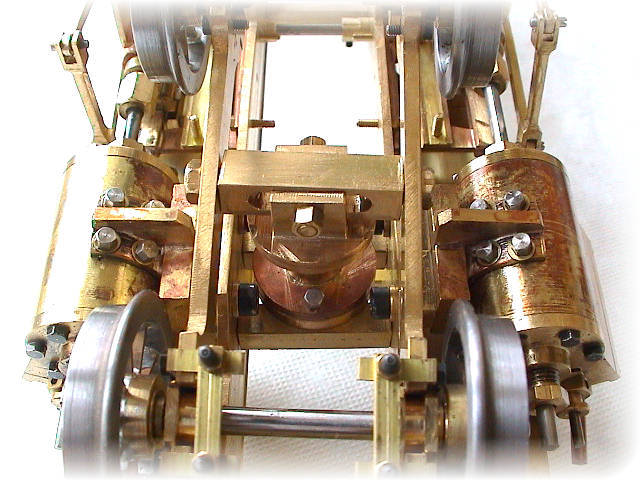 Unterstützend
wirkt da noch die kardanische Aufhängung, die dazu
beiträgt, dass eventuelle Unebenheiten im
Schienenverlauf, hervorragend ausgeglichen werden.
Vorweggenommen, auf den beiden Aufnahmen ist sehr
schön die Anordnung der Zylinderhalter am Rahmen
und die Befestigung der Zylinder selbst, zu sehen.
Dazu aber später mehr.
Unterstützend
wirkt da noch die kardanische Aufhängung, die dazu
beiträgt, dass eventuelle Unebenheiten im
Schienenverlauf, hervorragend ausgeglichen werden.
Vorweggenommen, auf den beiden Aufnahmen ist sehr
schön die Anordnung der Zylinderhalter am Rahmen
und die Befestigung der Zylinder selbst, zu sehen.
Dazu aber später mehr.
Die Räder
Wenn man so eine eigenwillige Maschine baut, stellt sich zwangsläufig die Frage nach den Rädern. Da es sich um eine Schnellzuglok handelt, weisen bei diesem Modell die Treib-u. Kuppelräder einen Durchmesser von 70 mm und die Laufräder des Drehgestells einen Durchmesser von 35 mm auf. Hier für fertige und gleichzeitig passende und preiswerte Räder auf dem Markt zu finden (Massstab 1:30 ?) ist fast unmöglich. Also wurden Überlegungen angestellt, selbst die Räder herzustellen.
Glücklicherweise gibt es Hobbyisten, die in
gleicher Richtung gedacht haben und in der
Herstellung solcher Räder schon richtig versiert
sind. Der Zufall wollte es, dass ich sogar in
meiner Heimatstadt einen Gleichgesinnten fand, der
schon des öfteren für seine eigenwilligen Modelle
solche Räder angefertigt hat.
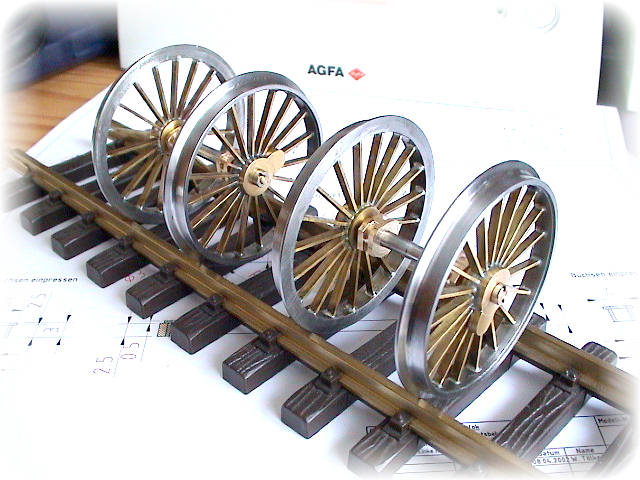 Als ich Ihm, bei einem ersten Kontakt,
die Pläne meiner Lok vorlegte, war er so
begeistert, dass er bereit war, das gleiche Modell
nach meinen Zeichnungen zu bauen und
selbstverständlich auch die Räder. Was die Räder
anbetrifft und was dabei heraus kam, lässt sich
sehr schön aus den Bildern
entnehmen.
Als ich Ihm, bei einem ersten Kontakt,
die Pläne meiner Lok vorlegte, war er so
begeistert, dass er bereit war, das gleiche Modell
nach meinen Zeichnungen zu bauen und
selbstverständlich auch die Räder. Was die Räder
anbetrifft und was dabei heraus kam, lässt sich
sehr schön aus den Bildern
entnehmen.
Die Radbandagen für die grossen Räder wurden
nach Zeichnung aus dem Material einer grossen
Hydraulikverschraubung gedreht. Die Radnabe ist
aus Messing hergestellt. In diese Nabe ist radial
eine Nute eingestochen, in die später mittels
Vorrichtung die Speichen (3 x 1 mm) stramm
eingesetzt und positioniert werden. Anschliessend
werden die Speichen mit der Nabe, unter Verwendung
eines speziellen, silberhaltigen, hochfesten
Weichlotes,
verlötet.
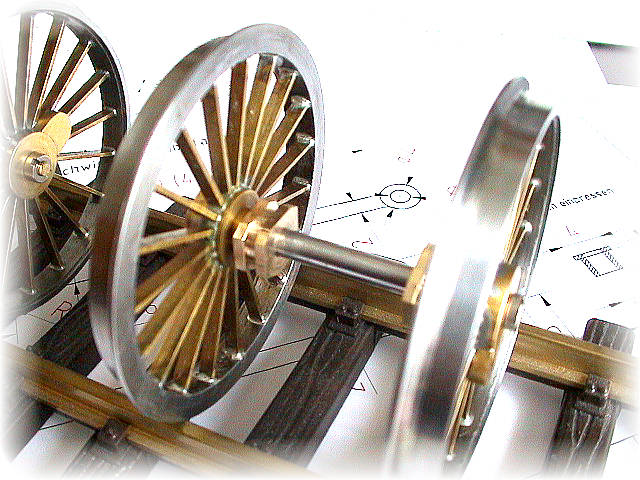 Bei dieser Gelegenheit wird auch
gleichzeitig der sichtbare Exzenterkörper
aufgelötet.
Bei dieser Gelegenheit wird auch
gleichzeitig der sichtbare Exzenterkörper
aufgelötet.
Die Vorrichtung ist so ausgebildet, dass die gesamte Einheit, Vorrichtung einschliesslich Speichen und verlöteter Nabe, in das Drehbankfutter gespannt werden kann. Es wird jetzt der genaue Durchmesser, über die Speichen gemessen, entsprechend dem Innendurchmesser der Radbandagen, gedreht. Sind die Masse eingehalten, passt die gesammte Einheit wiederum, leicht stramm, in die Radbandage und kann jetzt mit gleichem Lot verlötet werden.
Sind alle Lötarbeiten abgeschlossen, wird jedes Rad, wiederum über eine Drehvorrichtung, auf der Drehbank so ausgerichtet, dass ein genauer und schlagfreier Rundlauf erreicht wird. Jetzt kann die Achsbohrung eingebracht werden. Erfolg dieses Aufwandes war, ein fast absoluter Rundlauf. Der aufgelötete Exzenterkörper ist so angeordnet, dass die Kurbelzapfenbohrung genau zwischen zwei Speichenpaare,zu liegen kommt. Natürlich wurde auch für das Bohren der Kurbelzapfen-Kernlöcher, eine Vorrichtung eingesetzt, um sicherzustellen, dass alle Kurbelzapfen gleiche Position haben. Da die Kurbelzapfen eingeschraubt sind, wurde das Schneiden der Gewindelöcher im Radkörper, direkt nach dem Bohren des Kernloches, mit der Maschine, in einer Stellung erledigt. Dadurch wird eine genau winklige Anordnung der Gewinde erreicht. Diese Vorgehensweise ist sehr wichtig und gewährleistet später einen sauberen Rundlauf der Räder mit angebautem Gestänge.
Die erforderlichen Ausgleichgewichte werden später am oberen Ende der Speichen positioniert und entsprechend verschraubt. Eine hochfeste Klebverbindung ist auch denkbar. Nur die verschraubte Version gefällt mir besser, da man immer wieder was ändern kann.
Die Laufräder des Drehgestells wurden auf gleiche Weise gefertigt.
An dieser Stelle muss ich meinem begabten Hobby-Freund ein grosse Kompliment ob der Sorgfallt und Mühe bei der Herstellung der Räder machen, mit dem Fazit: "Man lernt nie aus!"
Anmerkung: Den Lieferanten, des von mir eingesetzte Speziallotes, habe ich in meiner Linkliste aufgenommen. Der von mir benutzte Weichlot hat die Bezeichnung: #878, S-SnAg5 Din EN 29453, Flussmitte: Z-40
Die Rauchkammer
Die Konstruktion
der Rauchkammer war von einigen Faktoren abhängig.
Grundsätzlich sollte die Rauchkammer kompl.
zerlegbar sein und ist somit aus 5 Baugruppen
gebildet. Eine Komponente ist der hintere
Rauchkammerring, der einerseits eine
Aufnahmepassung für den Kessel aufwies und
andereerseits einen Sitz für das Rauchkammerrohr
hat. Als Gegenstück war der vordere
Rauchkammerring ausgebildet, der einmal das
Rauchkammerrohr aufnahm und auf seiner Gegenseite
die Halterung für die Rauchkammertüre
hatte.
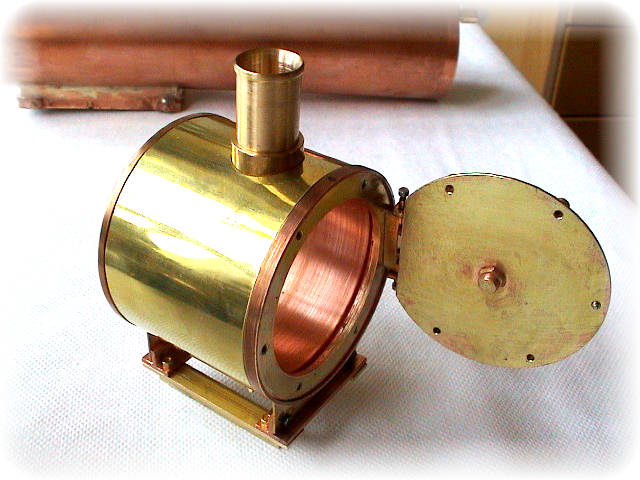 Der hintere und
vordere Rauchkammerring werden durch Steegbleche
und eine Verbindungskonsole in eine feste Position
gebracht. Diese Verbindungskonsole ruht wiederum
auf dem Maschinenrahmen und wird auch in diesem
geführt und befestigt. Im Rauchkammerrohr ist der
Schornstein integriert.
Die Rauchkammer
selbst wird mit einem 0.5 mm Messingblech
verkleidet. Seitlich rechts und links sind die
Auspuffleitungen der Zylinder
angebracht.
Der hintere und
vordere Rauchkammerring werden durch Steegbleche
und eine Verbindungskonsole in eine feste Position
gebracht. Diese Verbindungskonsole ruht wiederum
auf dem Maschinenrahmen und wird auch in diesem
geführt und befestigt. Im Rauchkammerrohr ist der
Schornstein integriert.
Die Rauchkammer
selbst wird mit einem 0.5 mm Messingblech
verkleidet. Seitlich rechts und links sind die
Auspuffleitungen der Zylinder
angebracht.
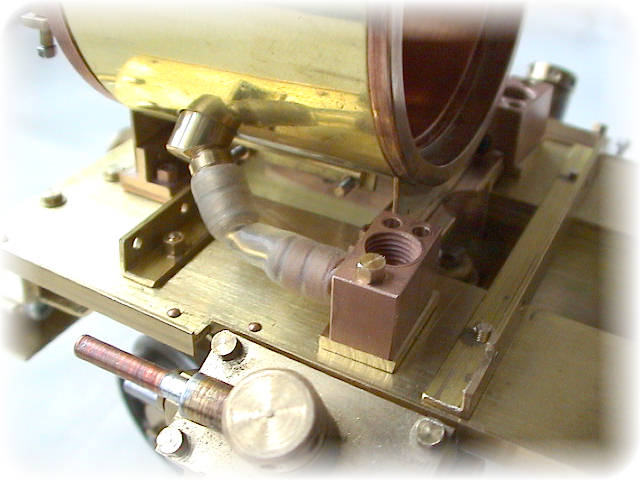 Damit die ganze
Einheit auch ohne grosse Probleme abnehmbar ist,
wurde eine Art Schottverbindung zu den unter der
Rahmenabdeckung liegenden Auspuffleitungen
geschaffen.
Damit die ganze
Einheit auch ohne grosse Probleme abnehmbar ist,
wurde eine Art Schottverbindung zu den unter der
Rahmenabdeckung liegenden Auspuffleitungen
geschaffen.
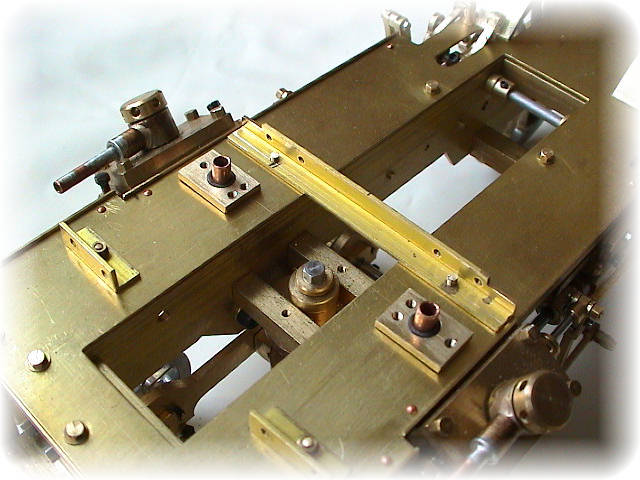 Ein auf dem
Rahmenblech lose angeordneter rechteckiger Flansch
mit eingelegtem O-Ring (rechtes Bild), wird mit
dem im linken Bild gezeigten Anschlussblock
verbunden und verschraubt. Der O-Ring wird hierbei
dicht mit der herausragenden Auspuffleitung
verpresst. Die weitere Verbindung zur Rauchkammer
erfolgt über Einschraubnippel und einem Stück
Teflon-Schlauch. Die grössere Öffnung im oberen
Flanschblock wird mit einem kurzen Gewindestopfen
noch dicht verschlossen. Damit war aber zunächst
nur das Problem der Abdampfleitungen
zufriedenstellend gelöst. Weit schwieriger sollte
sich aber die Zuführung der
Frischdampfleitungen zu den Zylinder
gestalten.
Ein auf dem
Rahmenblech lose angeordneter rechteckiger Flansch
mit eingelegtem O-Ring (rechtes Bild), wird mit
dem im linken Bild gezeigten Anschlussblock
verbunden und verschraubt. Der O-Ring wird hierbei
dicht mit der herausragenden Auspuffleitung
verpresst. Die weitere Verbindung zur Rauchkammer
erfolgt über Einschraubnippel und einem Stück
Teflon-Schlauch. Die grössere Öffnung im oberen
Flanschblock wird mit einem kurzen Gewindestopfen
noch dicht verschlossen. Damit war aber zunächst
nur das Problem der Abdampfleitungen
zufriedenstellend gelöst. Weit schwieriger sollte
sich aber die Zuführung der
Frischdampfleitungen zu den Zylinder
gestalten.
Der
Frischdampfaustritt befindet sich im vorderen Teil
des Kessels direkt über dem
Flammrohr.
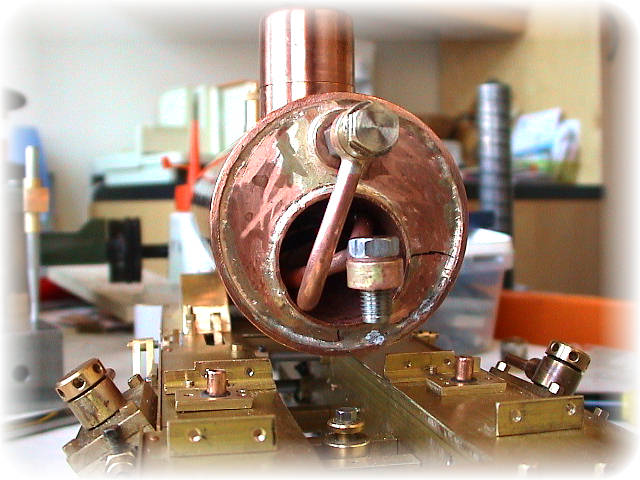
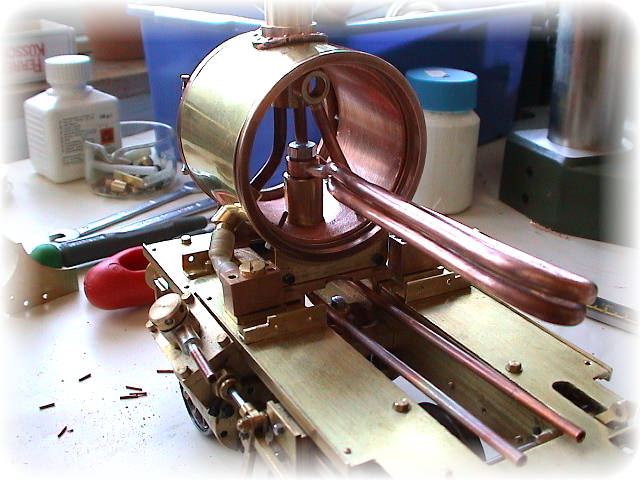 Von dort aus wird
der Dampf durch einen Überhitzer geleitet, der mit
zwei Windungen innerhalb des Flammrohres
integriert ist. Der Überhitzer endet in eine Art
Wingelverschraubung, die, wie im linken Bild zu
sehen ist, wiederum mit einer Art
Schottverschraubung in der Rauchkammer verbunden
wird.
Unterhalb der
Rauchkammer mündet dieser Durchbruch in ein
Verteilerstück, zur Versorgung des rechten und
linken Zylinders. Auf dem Bild links sind die
beiden herausgeführten Dampfleitungen zu sehen.
Hier ist auch der Überhitzer als ganze Einheit,
diesmal verschraubt mit der Rauchkammer, zu sehen.
Darüberhinaus ist noch die Anordnung des inneren
Teils der beiden Auspuffleitungen zu
erkennen.
Von dort aus wird
der Dampf durch einen Überhitzer geleitet, der mit
zwei Windungen innerhalb des Flammrohres
integriert ist. Der Überhitzer endet in eine Art
Wingelverschraubung, die, wie im linken Bild zu
sehen ist, wiederum mit einer Art
Schottverschraubung in der Rauchkammer verbunden
wird.
Unterhalb der
Rauchkammer mündet dieser Durchbruch in ein
Verteilerstück, zur Versorgung des rechten und
linken Zylinders. Auf dem Bild links sind die
beiden herausgeführten Dampfleitungen zu sehen.
Hier ist auch der Überhitzer als ganze Einheit,
diesmal verschraubt mit der Rauchkammer, zu sehen.
Darüberhinaus ist noch die Anordnung des inneren
Teils der beiden Auspuffleitungen zu
erkennen.
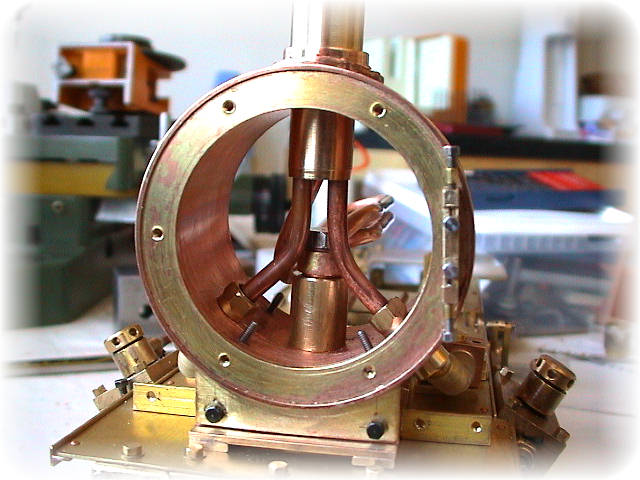 Durch die
besondere Installation dieser Auspuffleitungen
verspreche ich mir einen gewissen Sog in der
Rauchkammer, was einen besseren Rauchgasabzug
bewirken soll.
Durch die
besondere Installation dieser Auspuffleitungen
verspreche ich mir einen gewissen Sog in der
Rauchkammer, was einen besseren Rauchgasabzug
bewirken soll.
Um nochmals auf den Dampfverteiler unterhalb der Rauchkammer zu kommen, hier habe ich eine Änderung geplant. Es erfolgt von dieser Stelle aus jetzt keine Verteilung mehr an die Zylinder, sondern eine Zufuhr des Dampfes an ein speziell entwickeltes Drehschieberventil, welches vor der Rauchkammer, unterhalb des Kessels, zwischen den Rahmenwangen, etwa in Höhe der Schwinge angeordnet ist. Dieses Ventil versorgt zukünftig die Zylinder mit einer geregelten Dampfmenge. Durch ein Servo kann dieses Ventil über kurze Regelwege gesteuert werden. Das ist sicherlich nicht stilecht aber eine brauchbare Alternative. Die Funktion der Heusinger-Umsteuerung und die damit verbundene Möglichkeit der Einstellung der Füllungsverhältnisse im Zylinder, bleiben voll erhalten.
Ausschlaggebend für dieses Vorhaben war die Tatsache, dass die Maschine auf gerader Strecke, bedingt durch die grossen Räder, erheblich schnell ist. Ungeregelt würde sie aber in der nächsten Kurve herausfliegen. Da braucht man halt eine schnelle Dampfregulierung! Ich meine das dies eine Lösung darstellt. Alternativ käme auch noch die Realisierung einer echten Bremsfunktion über einen Bremszylinder in Frage. Siehe hierzu auch die Bremsen .
Der Kessel
Der Kessel wurde geplant als Langkessel mit
einer einfachen Feuerbuchse die wiederum in ein 28
mm Rauchrohr mündete. Als Basismaterial wurde für
den Kessel selbst ein handelsübliches, 54 mm
Kupferrohr verwendet.
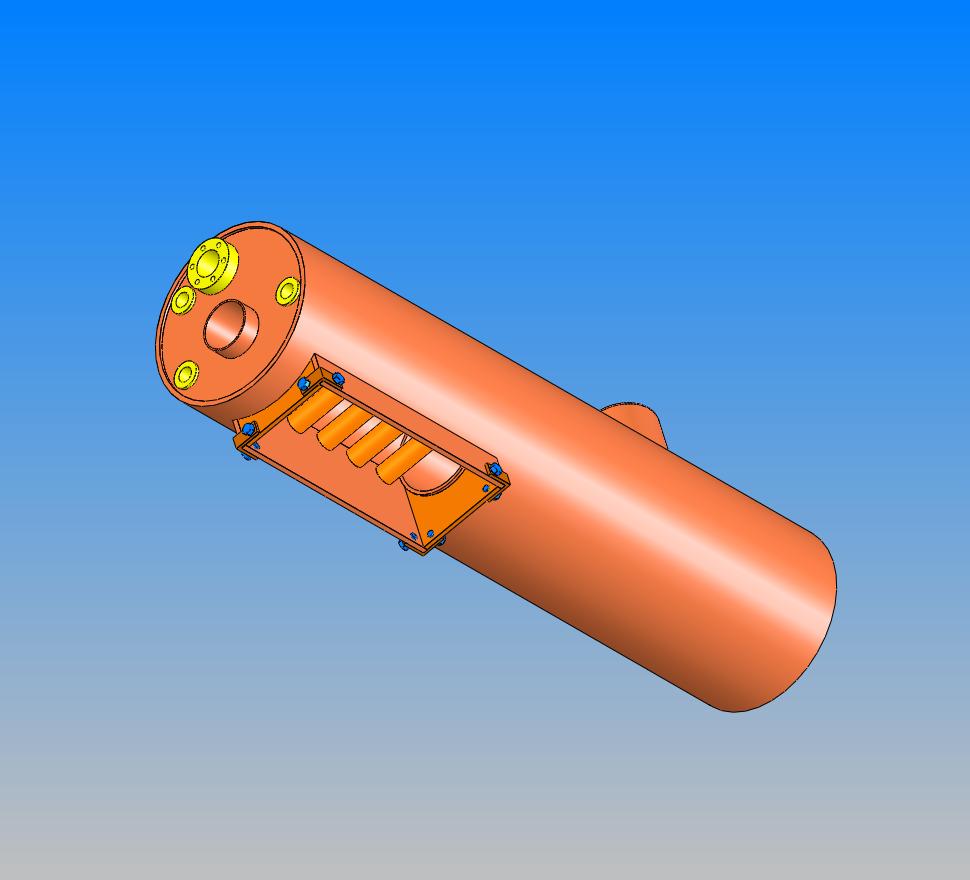 Die Feuerbuchse basiert auf einem
aufgesägten und aufgebogenem 28 mm Kupferrohr. Das
gleiche Rohr wurde schliesslich auch für das
Rauchrohr eingesetzt. Da ich von Beginn an, den
Einsatz eines
Keramik-Rechteckbrenners geplant hatte,
der eine überaus gute Heizleistung brachte,
glaubte ich auf Quersiederohre verzichten zu
können.
Diese Annahme sollte sich später bei der ersten
Inbetriebnahme als fatal herausstellen.
Die Feuerbuchse basiert auf einem
aufgesägten und aufgebogenem 28 mm Kupferrohr. Das
gleiche Rohr wurde schliesslich auch für das
Rauchrohr eingesetzt. Da ich von Beginn an, den
Einsatz eines
Keramik-Rechteckbrenners geplant hatte,
der eine überaus gute Heizleistung brachte,
glaubte ich auf Quersiederohre verzichten zu
können.
Diese Annahme sollte sich später bei der ersten
Inbetriebnahme als fatal herausstellen.
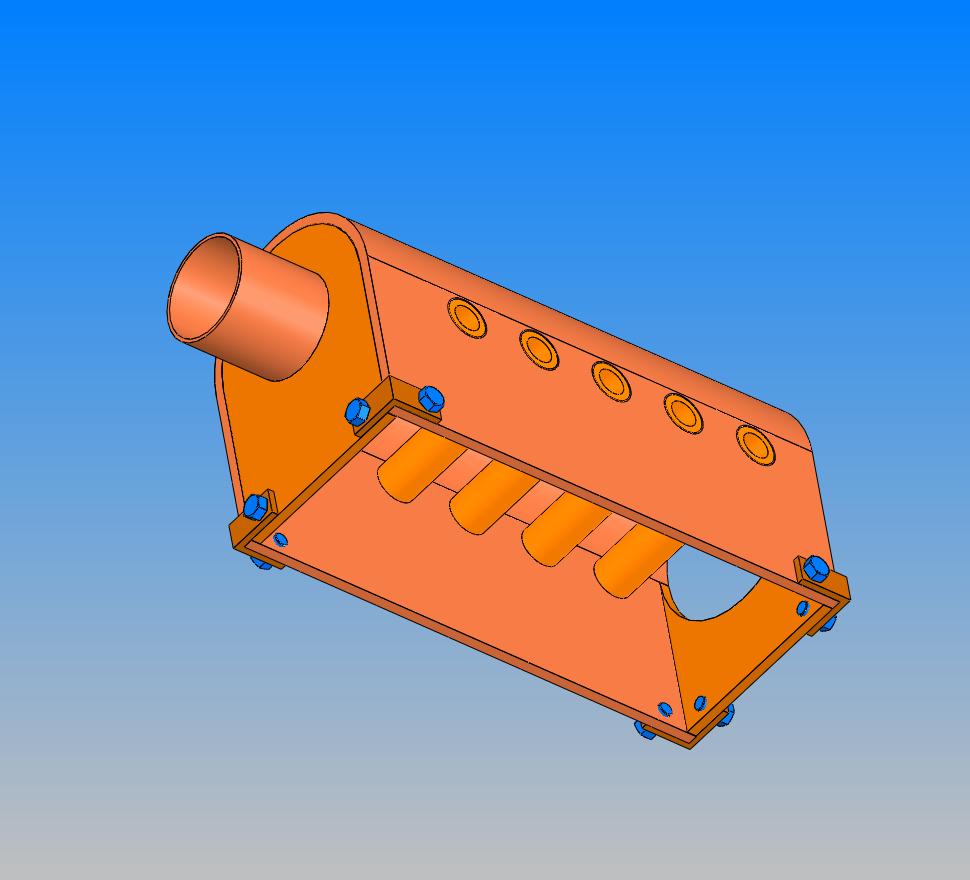 Die Umsetzung der Wärmeleistung des
Brenners in Dampfmenge und Druck war ohne
Siederohre so schlecht, daß ich nur raten kann,
soviel Siederohre einzubringen, wie technisch
machbar. Die beiden Grafiken zeigen dei Anordnung
der Siederohre in der Feuerbuchse. Gleiches gilt
auch für die Siederohre im Rauchrohr. Da eine
nachträgliche Änderung des Kessels nicht mehr
möglich war, müsste ich mich schweren Herzens zum
Bau eines neuen Kessels durchringen. Die bisherige
Kesselkonstruktion, jedoch mit Siederohren, kann
ich nur empfehlen. Sie ist aber
fertigungstechnisch schwierig zu bewerkstelligen.
Im Hinblick auf etwas mehr Wasservorrat, habe ich
den neuen Kessel etwas geändert. Die äusseren
Abmessungen und Armaturenanordnung
sind geblieben. Die Feuerbuchse und das
anschliessende Rauchrohr ist entfallen und als
Ersatz wurde ein durchgehendes 22 mm Flammrohr,
mit 6 diagonal und überkreuz angeordneten
Siederohren, eingebracht. Als Material wurde
diesmal Messing verwand. Die Siederohre allerding
sind aus Kupfer.
Die Umsetzung der Wärmeleistung des
Brenners in Dampfmenge und Druck war ohne
Siederohre so schlecht, daß ich nur raten kann,
soviel Siederohre einzubringen, wie technisch
machbar. Die beiden Grafiken zeigen dei Anordnung
der Siederohre in der Feuerbuchse. Gleiches gilt
auch für die Siederohre im Rauchrohr. Da eine
nachträgliche Änderung des Kessels nicht mehr
möglich war, müsste ich mich schweren Herzens zum
Bau eines neuen Kessels durchringen. Die bisherige
Kesselkonstruktion, jedoch mit Siederohren, kann
ich nur empfehlen. Sie ist aber
fertigungstechnisch schwierig zu bewerkstelligen.
Im Hinblick auf etwas mehr Wasservorrat, habe ich
den neuen Kessel etwas geändert. Die äusseren
Abmessungen und Armaturenanordnung
sind geblieben. Die Feuerbuchse und das
anschliessende Rauchrohr ist entfallen und als
Ersatz wurde ein durchgehendes 22 mm Flammrohr,
mit 6 diagonal und überkreuz angeordneten
Siederohren, eingebracht. Als Material wurde
diesmal Messing verwand. Die Siederohre allerding
sind aus Kupfer.
 Für die Befeuerung
mußte ich natürlich einen neuen Rohrbrenner
entwickeln und da wollte ich auch nicht auf meine
bewährten Keramikkonstruktionen verzichten. Wie
schon bei meiner BR 80 war eine lange
Versuchsreihe erforderlich um die geeignete
Brennerform zu kreieren. Die Schwierigkeit besteht
nicht darin einen Rohr-Keramik-Brenner zu bauen
sondern das Problem ergibt sich aus der Tatsache,
daß der Rohrbrenner ausserhalb des Flammrohres ein
wesentlich anderes Brennverhalten zeigt als im
Flammrohr.
Für die Befeuerung
mußte ich natürlich einen neuen Rohrbrenner
entwickeln und da wollte ich auch nicht auf meine
bewährten Keramikkonstruktionen verzichten. Wie
schon bei meiner BR 80 war eine lange
Versuchsreihe erforderlich um die geeignete
Brennerform zu kreieren. Die Schwierigkeit besteht
nicht darin einen Rohr-Keramik-Brenner zu bauen
sondern das Problem ergibt sich aus der Tatsache,
daß der Rohrbrenner ausserhalb des Flammrohres ein
wesentlich anderes Brennverhalten zeigt als im
Flammrohr.
 Ferner spielt die
Ferner spielt die
 Luftzufuhr, gemeint ist der Ringspalt
zwischen Brenner und Flammrohr, eine ungemein
wichtige Rolle. Auch die Ausbildung der Gasdüse
ist anders geartet. Verwendung findet eine
modifiziere Düse der Firma Rotenberger.
Modifiziert heißt in diesem Fall, daß die ohnehin
schon sehr winzige Düsenöffnung durch stauchen
noch weiter verringert wurde, bis sich das
richtige Gas-Luftgemisch einstellte. Ferner
ist für ein gutes Brennverhalten die Eintauchtiefe
des Brenners in das Flammrohr interessant. Wird
der Brenner zu weit in das Flammrohr geschoben,
glüht die Keramik nicht optimal und der Brenner
trompetet. Umgekehrt kann die Flamme aus dem
Flammrohr herausschlagen, was eigentlich nicht
Sinn der Sache ist.
Luftzufuhr, gemeint ist der Ringspalt
zwischen Brenner und Flammrohr, eine ungemein
wichtige Rolle. Auch die Ausbildung der Gasdüse
ist anders geartet. Verwendung findet eine
modifiziere Düse der Firma Rotenberger.
Modifiziert heißt in diesem Fall, daß die ohnehin
schon sehr winzige Düsenöffnung durch stauchen
noch weiter verringert wurde, bis sich das
richtige Gas-Luftgemisch einstellte. Ferner
ist für ein gutes Brennverhalten die Eintauchtiefe
des Brenners in das Flammrohr interessant. Wird
der Brenner zu weit in das Flammrohr geschoben,
glüht die Keramik nicht optimal und der Brenner
trompetet. Umgekehrt kann die Flamme aus dem
Flammrohr herausschlagen, was eigentlich nicht
Sinn der Sache ist.
Facit: Beide Kesselkonstruktionen sind gleichwertig geeignet! Aber grundsätzlich sollten immer so viele Siederohre eingebracht werden, wie technisch vertretbar. Nur so ist ein ausreichende Wärmeumsetzung erreichbar.
Die Steuerung
Zur Zeit bin ich dabei eine genauere Beschreibung der Steuerung zu erstellen. Diesbezüglich habe ich auch ein Computer-Programm entwickelt, welches nach Eingabe von bestimmten Abmessungsdaten des Triebwerkes, alle wichtigen, auf den Modellmassstab abgetimmte, Komponentendaten der Triebwerksteile, ausgibt. Soviel möchte ich jetzt schon vorausschicken - die nach den gewonnen Daten ausgeführte Steuerung funktionierte auf Anhieb zufrieden stellend. Allerdings hat auch so ein Computerprogramm so seine Tücken. Offensichtlich liegt es hier aber am Programmierer. Solange es sich um Eingaben der Baugrösse Spur 1 handelt, spuckt der Computer brauchbare Werte aus. Werden jedoch grössere Maßstäbe hinterlegt, werden die Ergebnisse unakzeptabel. Ich arbeite daran...
Bitte haben Sie aber noch etwas Geduld...
Die Bremsen
Auch eine Modell-Lokomotive sollte schon
von der Optik her über ein dem Original annähernd
entsprechendes Bremssystem verfügen. Ich habe
versucht das zu realisieren und ich glaube
es
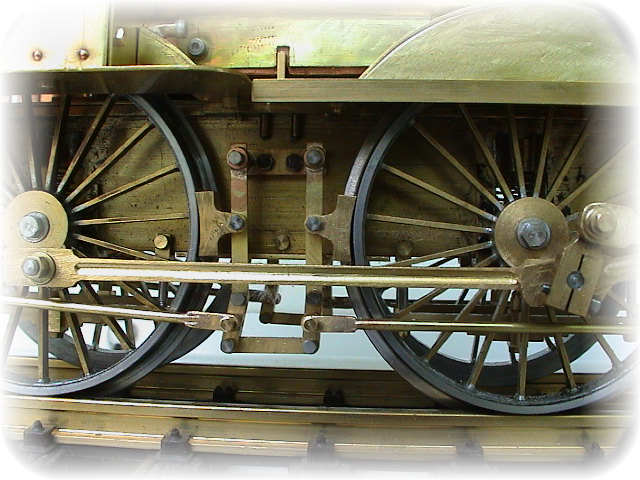 ist
mir ganz gut gelungen. Da, wie schon erwähnt, die
Originalunterlagen für diese Maschine schon kaum
aufzutreiben sind,
ist
mir ganz gut gelungen. Da, wie schon erwähnt, die
Originalunterlagen für diese Maschine schon kaum
aufzutreiben sind,
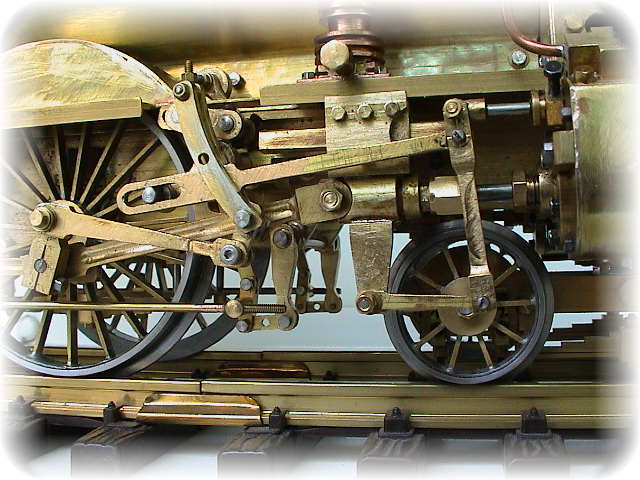 musste
ich mal wieder alte Fotos unter die Lupe nehmen
und habe daraus die Systematik des Bremssystems
der S 6 abgeleitet. Es war schon sehr schwierig
auf engstem Raum das Bremsgestänge mit dem
Maschinenrahmen zu verbinden und zwar so, dass
auch eine richtige Bremsfunktion zustande kommt.
Besonders problematisch war die Unterbringung des
Hebelsystems vor dem ersten Treibrad. Die
Platzverhältnisse sind hier ausserst bescheiden.
Aber ich denke es ist mir gelungen, wie man auch
auf den Bilder sehen kann. Es ergab sich sogar
noch die Option, zur Auslösung einer
musste
ich mal wieder alte Fotos unter die Lupe nehmen
und habe daraus die Systematik des Bremssystems
der S 6 abgeleitet. Es war schon sehr schwierig
auf engstem Raum das Bremsgestänge mit dem
Maschinenrahmen zu verbinden und zwar so, dass
auch eine richtige Bremsfunktion zustande kommt.
Besonders problematisch war die Unterbringung des
Hebelsystems vor dem ersten Treibrad. Die
Platzverhältnisse sind hier ausserst bescheiden.
Aber ich denke es ist mir gelungen, wie man auch
auf den Bilder sehen kann. Es ergab sich sogar
noch die Option, zur Auslösung einer
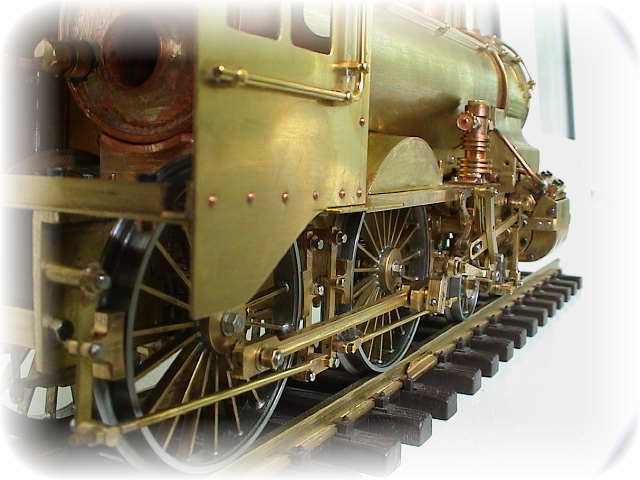 Bremsfunktion,
in diesem Bereich noch später einen Bremszylinder,
wie beim Original, zu plazieren. In diesem
Zusammenhang verweise ich auf die Ausführungen zur
Dampfverteilung im Abschnitt
Rauchkammer
Bremsfunktion,
in diesem Bereich noch später einen Bremszylinder,
wie beim Original, zu plazieren. In diesem
Zusammenhang verweise ich auf die Ausführungen zur
Dampfverteilung im Abschnitt
Rauchkammer
Die Verbindungselemente für Hebel und Ausgleichselemente bestehen aus VA-M 1,6 Schrauben und Muttern. Für die Befestigung der Bremsenkonsolen am Rahmen kamen M 2 Schrauben in Frage.
Die Zylinder
Wie schon bei meiner BR 80 erfolgreich
praktiziert, habe ich bei der S 6 von vorne herein
die Zylinder mit einer Flachschiebersteuerung
ausgestattet. Das ist zwar etwas komplizierter in
der Ausführung, hat aber schön dichte Schieber zur
Folge. Der Kolben besitz eine zwei geteilte
Kolbenstange zur besseren Kolbenführung. Die
Zylinderdeckel sind somit auf beiden Seiten des
Zylinders mit einstellbaren Stopfbuchsen versehen.
Zur Abdichtung können sowohl O-Ringe als
auch Teflonschnur verwendet
werden.
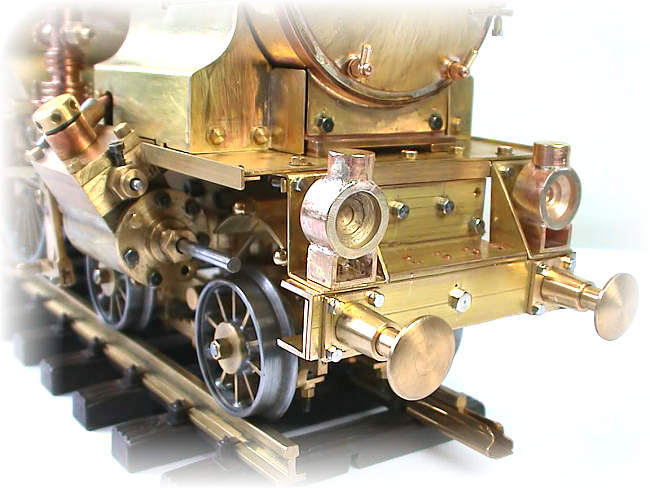 Der
Kolben ist passgenau gedreht und mit 4
Labyrintnuten versehen. zusätzlich ist noch eine
Nute 2 x 2 mm eingestochen, für eine
Teflonpackung.
Der
Kolben ist passgenau gedreht und mit 4
Labyrintnuten versehen. zusätzlich ist noch eine
Nute 2 x 2 mm eingestochen, für eine
Teflonpackung.
Auch das Schiebergehäuse ist beidseitig mit
Führungen und
Stopfbuchsen
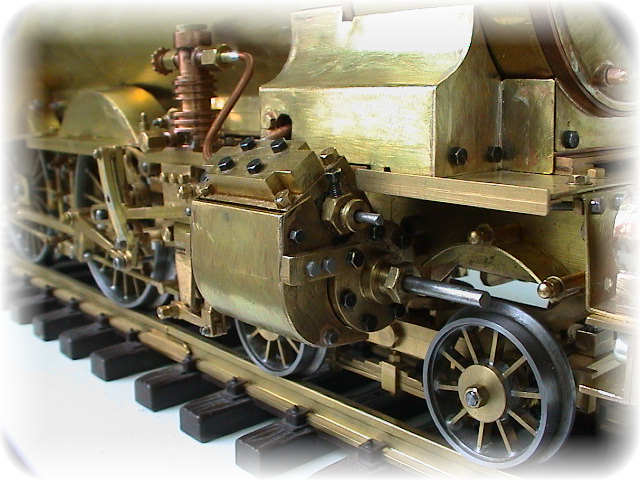 versehen
und der Schieber wird von einer durchgehenden
Schieberstange bewegt. Ein verschraubbarer
Mitnehme in der Mitte des Schiebers gestattet ein
sauberes Einstellen der
Steuerung.
versehen
und der Schieber wird von einer durchgehenden
Schieberstange bewegt. Ein verschraubbarer
Mitnehme in der Mitte des Schiebers gestattet ein
sauberes Einstellen der
Steuerung.
Die Bauweise der S6 erfordert einen relativ
starken Versatz der Schiebermitte zur Kolbenmitte
nach aussen. Dadurch erhält man den erforderlichen
Freiraum im Bereich des Kreuzkopfes und der
Kolbenstange. Dieses Problem habe ich durch eine
Schrägstellung des Zylinder erreicht. Hier zeigte
sich die Nützlichkeit der Zylinderlagerung, die
gleichzeitig Zylinderbefestigung und Befestigung
zum Rahmen hin ist. Da mir diese
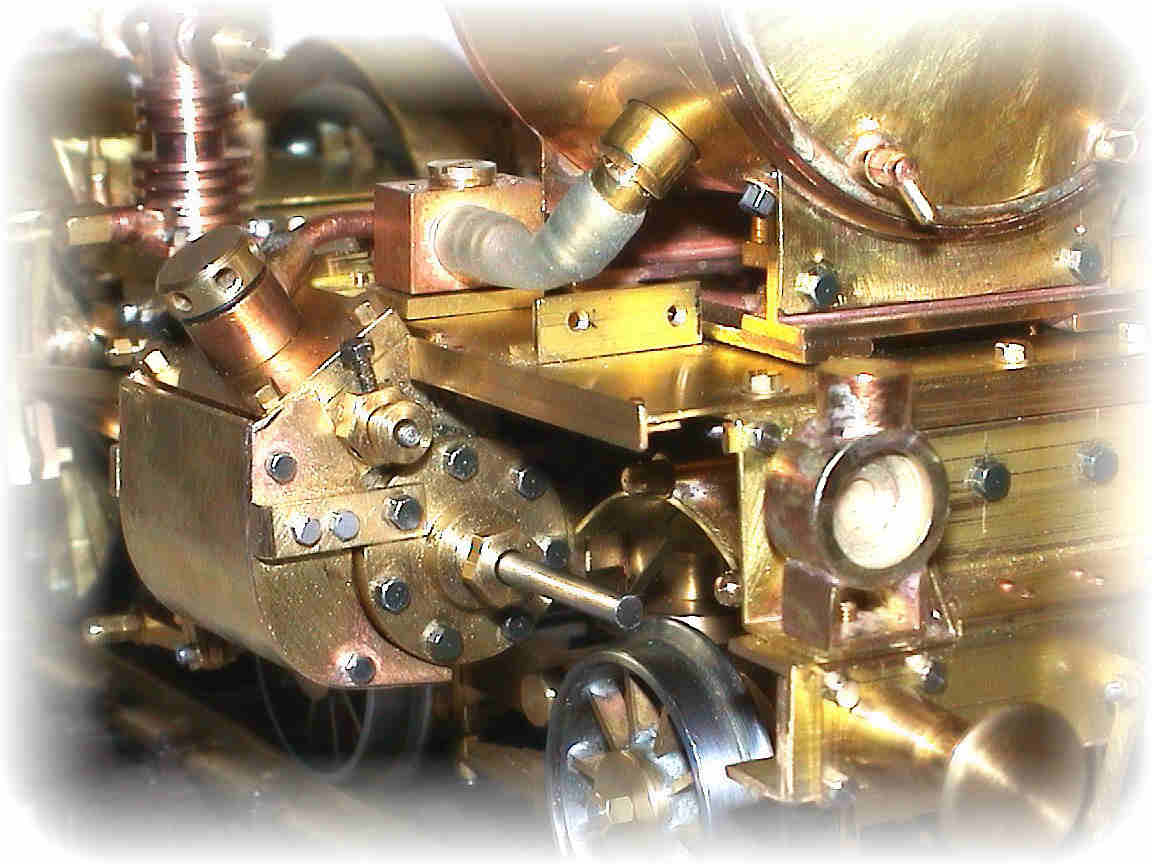 erste
Ausführung des Dampfanschlusses nicht so besonders
gefiel, habe ich alles nochmals geändert und auch
den Dampfanschluss neu erarbeitet. Das Prinzip
der
Zylinderschrägstellung wurde aber beibehalten.
Die Sache sieht jetzt etwas gefälliger aus. Auch
hierzu ein paar Bilder zur besseren Information.
Auf dem rechten Bild ist sehr schön der neue
Dampfanschluss und die Zylinderverkleidung zu
sehen. Das Imitat Luftpumpe ist umfunktioniert als
Verdrängungsöler. Über ein Ventil lässt sich die
Ölmenge einstellen. Die kleine 2 mm Dampfleitung
mündet direkt in der
Schieberkammer.
erste
Ausführung des Dampfanschlusses nicht so besonders
gefiel, habe ich alles nochmals geändert und auch
den Dampfanschluss neu erarbeitet. Das Prinzip
der
Zylinderschrägstellung wurde aber beibehalten.
Die Sache sieht jetzt etwas gefälliger aus. Auch
hierzu ein paar Bilder zur besseren Information.
Auf dem rechten Bild ist sehr schön der neue
Dampfanschluss und die Zylinderverkleidung zu
sehen. Das Imitat Luftpumpe ist umfunktioniert als
Verdrängungsöler. Über ein Ventil lässt sich die
Ölmenge einstellen. Die kleine 2 mm Dampfleitung
mündet direkt in der
Schieberkammer.
Bedingt durch meine beschränkten Fertigungsmöglichkeiten habe ich die Zylinderkörper und die Schieberkästenspiegel getrennt gefertigt und letztere hart auf den Zylinderkörper aufgelötet. Wer die besseren Fertigungsmöglichkeiten hat, sollte auf der Fräsmaschine den Zylinder und Schieberspiegel aus einem Stück, mit dem entsprechenden Versatz, fertigen.
Hinsichtlich des
Tenders gab es im Original offensichtlich mehrere
Ausführungen. Dies lässt sich aus dem
wenigen
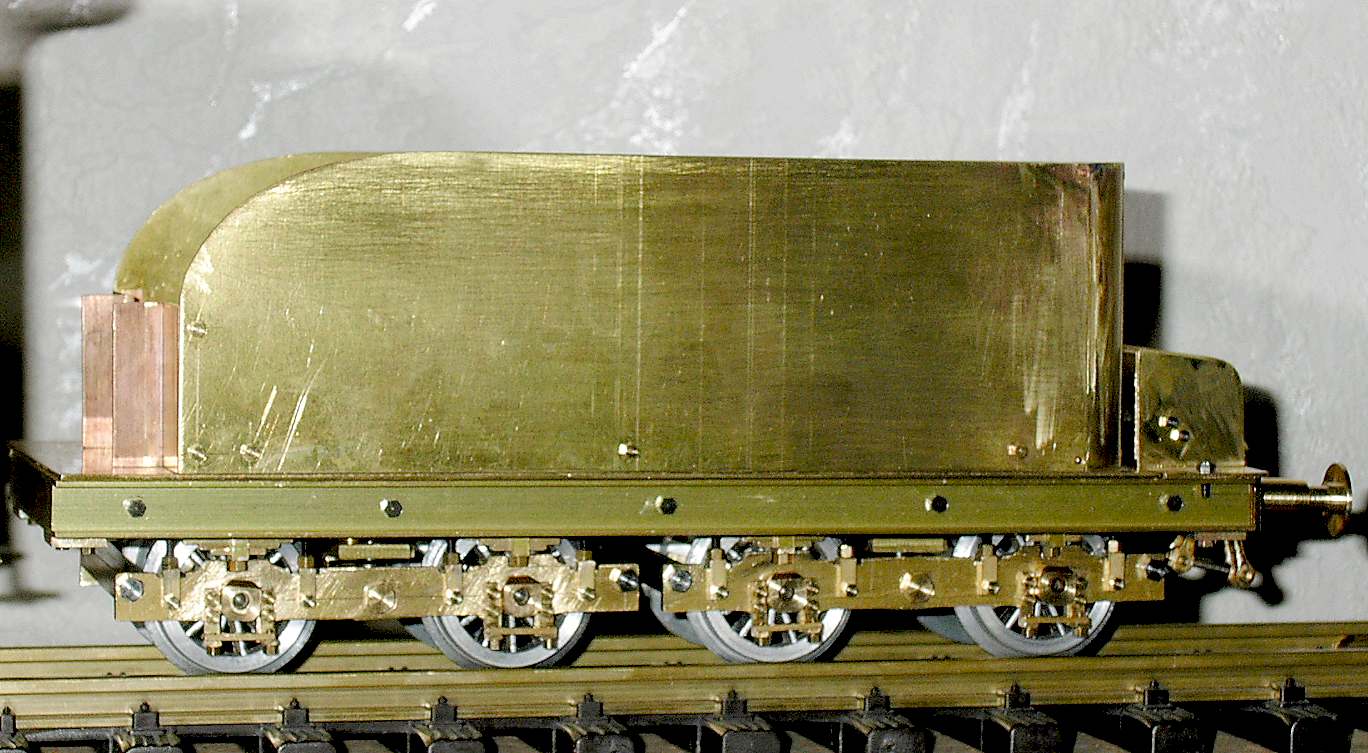 Bildmaterial, was
mir zur Verfügung stand, ableiten. Die von mir
gewählte Tenderkonstruktion basiert zunächst
einmal auf einen stabilen Messing-U-Profil-Rahmen,
der am Tenderende eine Quertraverse, zur Aufnahme
der Puffer und des Kupplungsgeschirrs, aufweist.
In den Basisrahmen integriert ist eine zweite
Konstruktion verschraubt, die die Anordnung
der beiden Drehgestelle erlaubt.
Bildmaterial, was
mir zur Verfügung stand, ableiten. Die von mir
gewählte Tenderkonstruktion basiert zunächst
einmal auf einen stabilen Messing-U-Profil-Rahmen,
der am Tenderende eine Quertraverse, zur Aufnahme
der Puffer und des Kupplungsgeschirrs, aufweist.
In den Basisrahmen integriert ist eine zweite
Konstruktion verschraubt, die die Anordnung
der beiden Drehgestelle erlaubt.
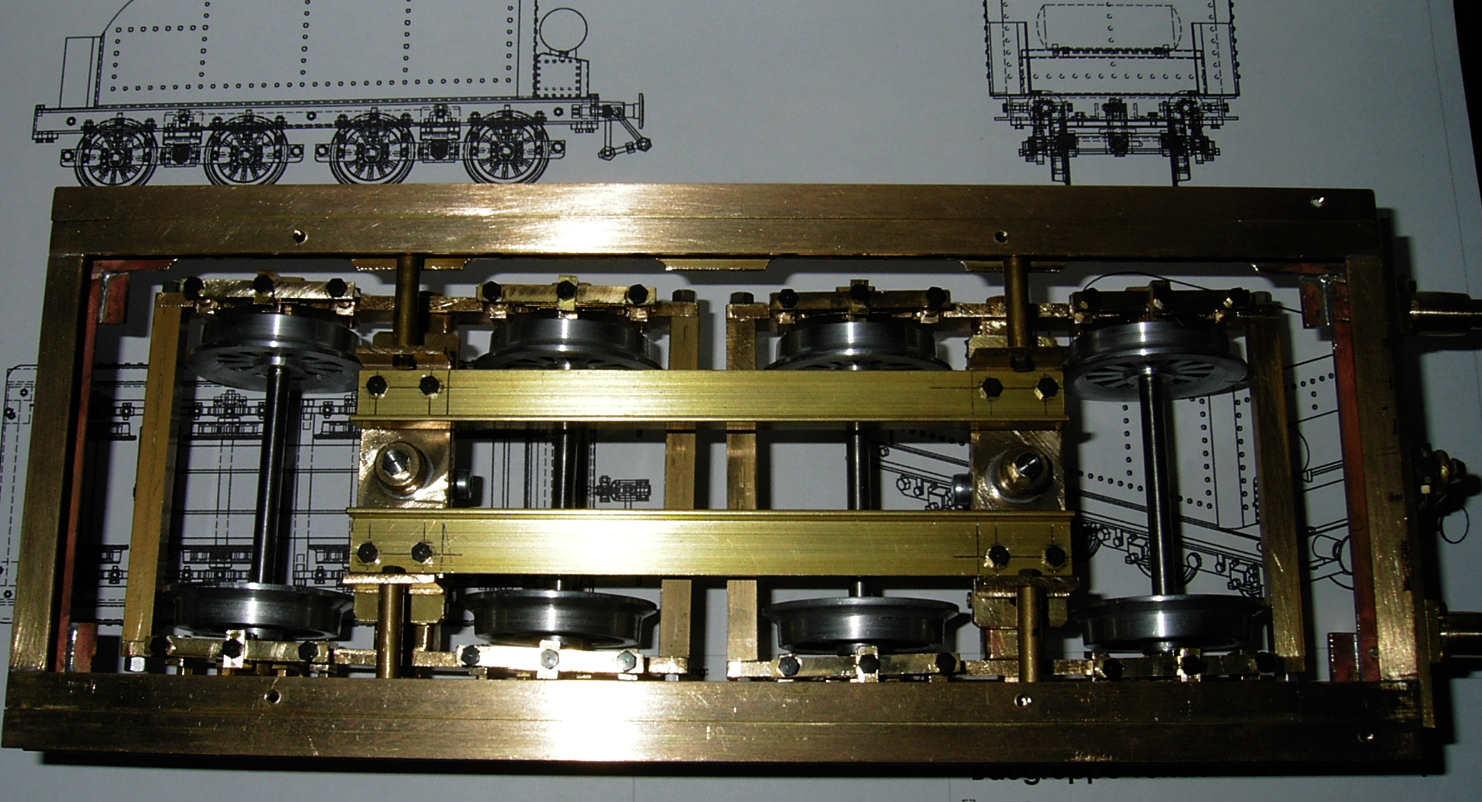 Hierbei wurden
zwei Längs-U-Profile mit den beiden Drehschemeln
für die Drehestelle zu einer Einheit zusammen
gefügt und mit den Basisträgern des Tenders
verbunden. Alles ist so konstruiert, dass das
ganze Tragwerk komplett wieder zerlegt werden
kann.
Hierbei wurden
zwei Längs-U-Profile mit den beiden Drehschemeln
für die Drehestelle zu einer Einheit zusammen
gefügt und mit den Basisträgern des Tenders
verbunden. Alles ist so konstruiert, dass das
ganze Tragwerk komplett wieder zerlegt werden
kann.
Die Drehgestelle
zum Tender sind baugleich.
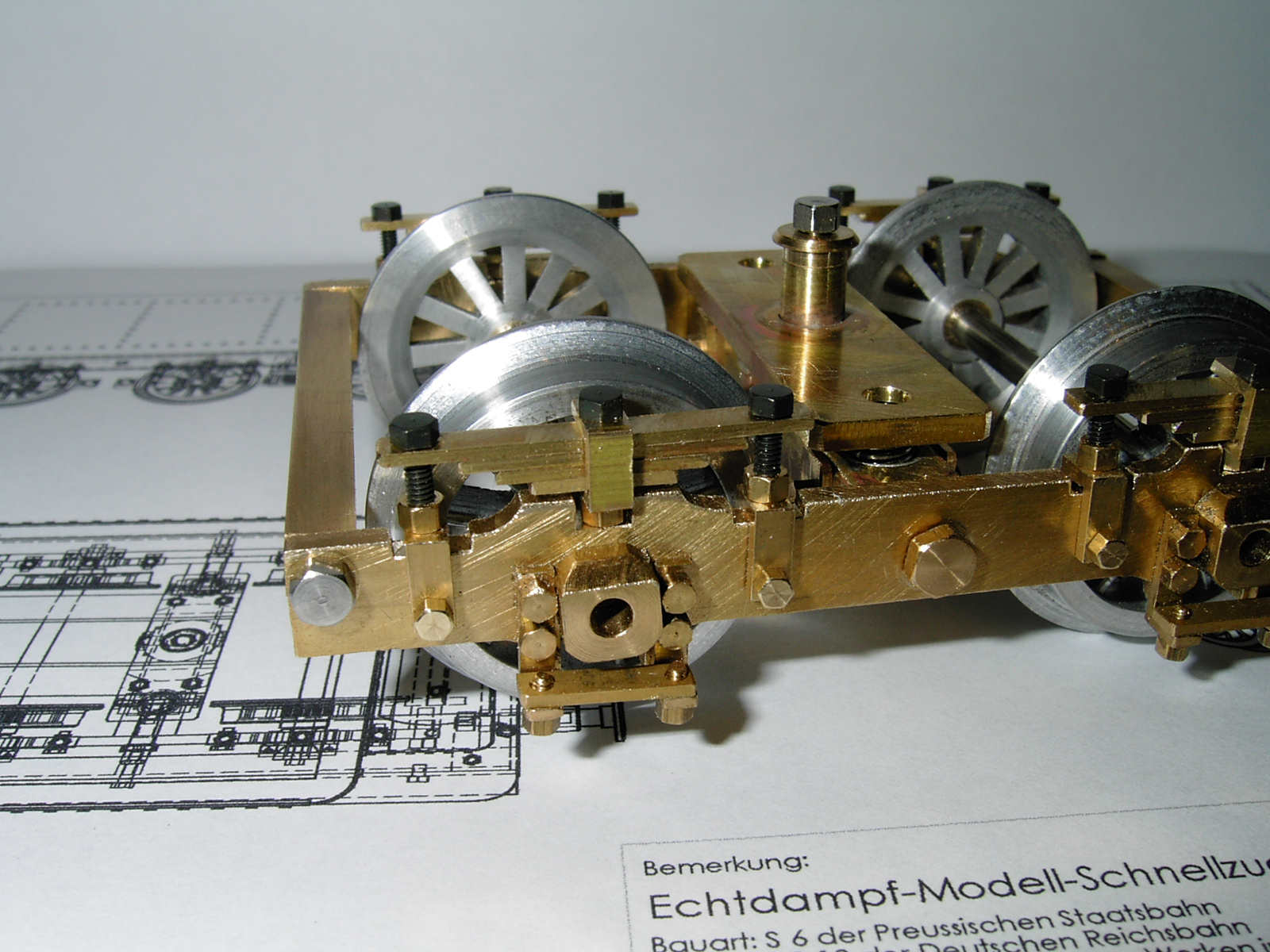 Mittig im
Drehgestellrahmen ist die Aufnahme für die
Drehtraverse, ausgebildet als Drehpunkt in
Längsrichtung. Die eigentliche Drehtraverse ist
nochmals zweigeteilt und beinhaltet eine
Federwippe in Querrichtung.
Zusammen ergibt
dies eine kardanische Funktion für das
Drehgestell, die Gleisunebenheiten in allen
Richtungen bestens ausgleiht. Auf eine eigentliche
Achsfederung konnte dadurch verzichtet weden.
Dennoch sind an jedem Laufradlager Federpackete
als Attrappe angeordnet um dem Original möglichst
gerecht
Mittig im
Drehgestellrahmen ist die Aufnahme für die
Drehtraverse, ausgebildet als Drehpunkt in
Längsrichtung. Die eigentliche Drehtraverse ist
nochmals zweigeteilt und beinhaltet eine
Federwippe in Querrichtung.
Zusammen ergibt
dies eine kardanische Funktion für das
Drehgestell, die Gleisunebenheiten in allen
Richtungen bestens ausgleiht. Auf eine eigentliche
Achsfederung konnte dadurch verzichtet weden.
Dennoch sind an jedem Laufradlager Federpackete
als Attrappe angeordnet um dem Original möglichst
gerecht
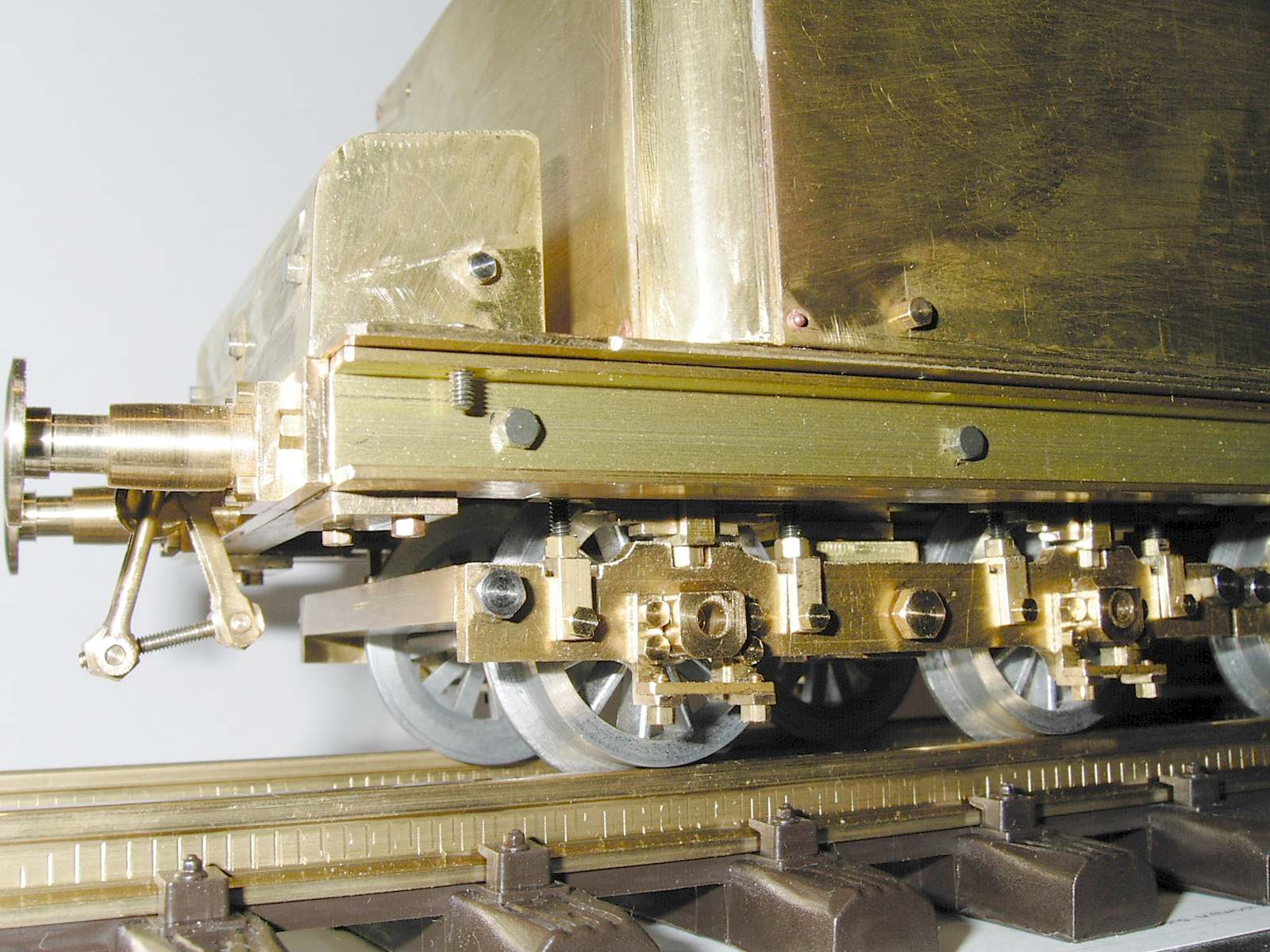 zu
werden.
zu
werden.
Die Tenderwanne ist aus 0.8 mm Messingblech hergestellt. ZurAusgestaltung der hinteren Wannenecken wurden 1/4 Teile eines 18mm Messingrohres genutzt und weich eingelötet. Auf den hinteren Teil des Tenders, oberhalb der Puffer, ist ein Werkzeugkasten angeordnet. Wie beim Original wird auf diesen Kasten noch ein Brems-Luftkessel aufgesetzt der auf den vorliegenden Bildern allerdings noch nicht zu sehen ist.
Das innere der
Tenderwanne wird von zwei Speisewassertanks,
mit zusammen etwa 180 ml Inhalt und dem
Gastank für den Keramikbrenner
ausgefüllt.
 Es bleibt aber
noch Platz für eine Speisewasserpumpe und einer
eventuellen Fernsteuerung.
Es bleibt aber
noch Platz für eine Speisewasserpumpe und einer
eventuellen Fernsteuerung.
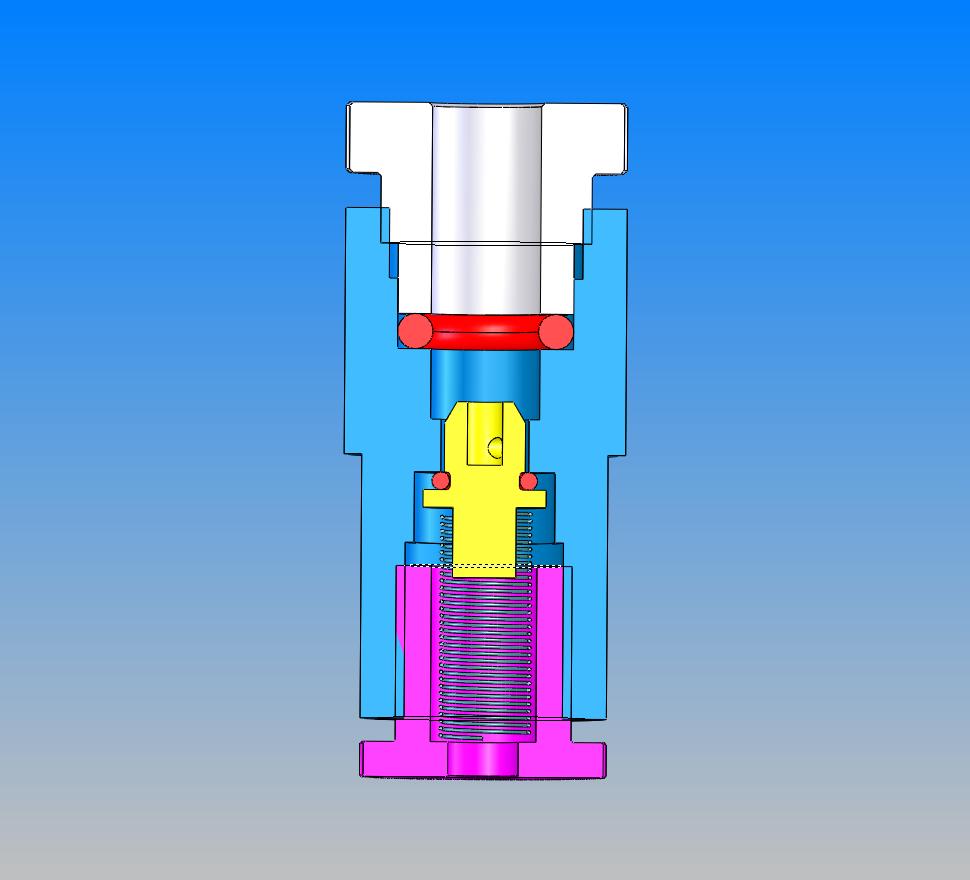 Als Gastank hatte
ich ursprünglich die "minigas 100" Kartuschen von
ROTHENBERGER vorgesehen. Das wäre eine
praktische Sache gewesen, hatte aber leider einen
Haken. Die Kartusche muß zum Ventil hin schäg noch
oben gelegt werden, da sonst Flüssiggas in die
Brennerleitung gelangt und das wiederum kann
bösartige Folgen am Brenner haben. Also wurde die
Sache geändert und ein Gastank aus Messing
Vierkantrohr, 40 x 20 x 165 mm, hergestellt. Ein
eigens entwickeltes Gas-Füllventil und ein
Regelventil mit Gasschnellkupplung sind auf der
Oberseite des Gastanks dicht eingeschraubt. Leider
haben die Flüssiggasbehälter die negative
Eigenschaft, bei Gasentnahme, sich in einen
Kühlschrank zu verwandeln, was sich wiederum
ungünstig auf die Brennerleistung auswirkt.
Märklin löst dieses Problem durch Anordnung des
Gasbehälters im Wasserbad. Eine sehr gute Lösung,
nur ich habe nicht genügend Platz. Kommt Zeit
kommt Rat. Eine Lösung wird es sicherlich
geben.
Als Gastank hatte
ich ursprünglich die "minigas 100" Kartuschen von
ROTHENBERGER vorgesehen. Das wäre eine
praktische Sache gewesen, hatte aber leider einen
Haken. Die Kartusche muß zum Ventil hin schäg noch
oben gelegt werden, da sonst Flüssiggas in die
Brennerleitung gelangt und das wiederum kann
bösartige Folgen am Brenner haben. Also wurde die
Sache geändert und ein Gastank aus Messing
Vierkantrohr, 40 x 20 x 165 mm, hergestellt. Ein
eigens entwickeltes Gas-Füllventil und ein
Regelventil mit Gasschnellkupplung sind auf der
Oberseite des Gastanks dicht eingeschraubt. Leider
haben die Flüssiggasbehälter die negative
Eigenschaft, bei Gasentnahme, sich in einen
Kühlschrank zu verwandeln, was sich wiederum
ungünstig auf die Brennerleistung auswirkt.
Märklin löst dieses Problem durch Anordnung des
Gasbehälters im Wasserbad. Eine sehr gute Lösung,
nur ich habe nicht genügend Platz. Kommt Zeit
kommt Rat. Eine Lösung wird es sicherlich
geben.
© 2001 by • Wilhelm Tölke